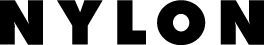Mut zur Befreiung aus der eigenen Familie: Eine Leseprobe aus „Das wirkliche Leben” von Adeline Dieudonné
Heile Familienwelt ist in diesem Bestseller Fehlanzeige. In „Das wirkliche Leben” sieht sich ein junges Mädchen gezwungen, ihren ganzen Mut zusammen zu nehmen, um sich und ihren kleinen Bruder vor dem väterlichen Einfluss zu retten. Mehr lest ihr hier in der Leseprobe aus „Das wirkliche Leben” von Adeline Dieudonné.
Nach außen hin wirkt diese Familie wie das gängige Klischee: Vater, Mutter und zwei Kinder leben in einer beschaulichen Reihenhaussiedlung am Waldrand. Niemand ahnt jedoch, dass hier Bedrohung mit im Haus wohnt: Der machthungrige Vater. Er vernachlässigt sowohl seine Frau als auch seinen Sohn und seine Tochter, die Hauptfigur des Romans. Neben Fernsehen und Whiskey hat der Vater nur die Großwildjagd im Kopf. Je mehr seine Tochter zur jungen Frau heranwächst, desto mehr wird jedoch sie selbst zur Beute. Währenddessen kümmert sie sich seit Jahren trotz innerer Einsamkeit liebevoll um ihren Bruder – als sich aber eines Abends vor ihren Augen eine Tragödie abspielt, beginnt der wahre Kampf.
Der Roman „Das wirkliche Leben” ist ein Teil des dtv-Themenspecials #wasfürfrauen, in dem sich Heldinnen ganz unterschiedlichen Herausforderungen stellen: unerwarteten Schicksalsschlägen, einengenden Rollenbildern, destruktiven Beziehungen – und immer auch sich selbst. Mutig kämpfen sie sich frei von äußeren und inneren Zwängen.
Steht ihr auf Romane mit hohem Spannungsfaktor? Dann werdet ihr diesen lieben. „Das wirkliche Leben” von Adeline Dieudonné stand monatelang auf der französischen Bestsellerliste und hat insgesamt 14 Literaturpreise erhalten. Klar, dass keine Sprachbarriere mehr zwischen diesem fesselnden Buch und zukünftigen Lesern stehen soll und es deswegen nun in 20 Sprachen übersetzt wird. In Deutschland gelang dem Roman auch direkt der Sprung in die Top Ten der SPIEGEL-Bestsellerliste. Lucky us: Wir dürfen hier einen Auszug der deutschen Version mit euch teilen!
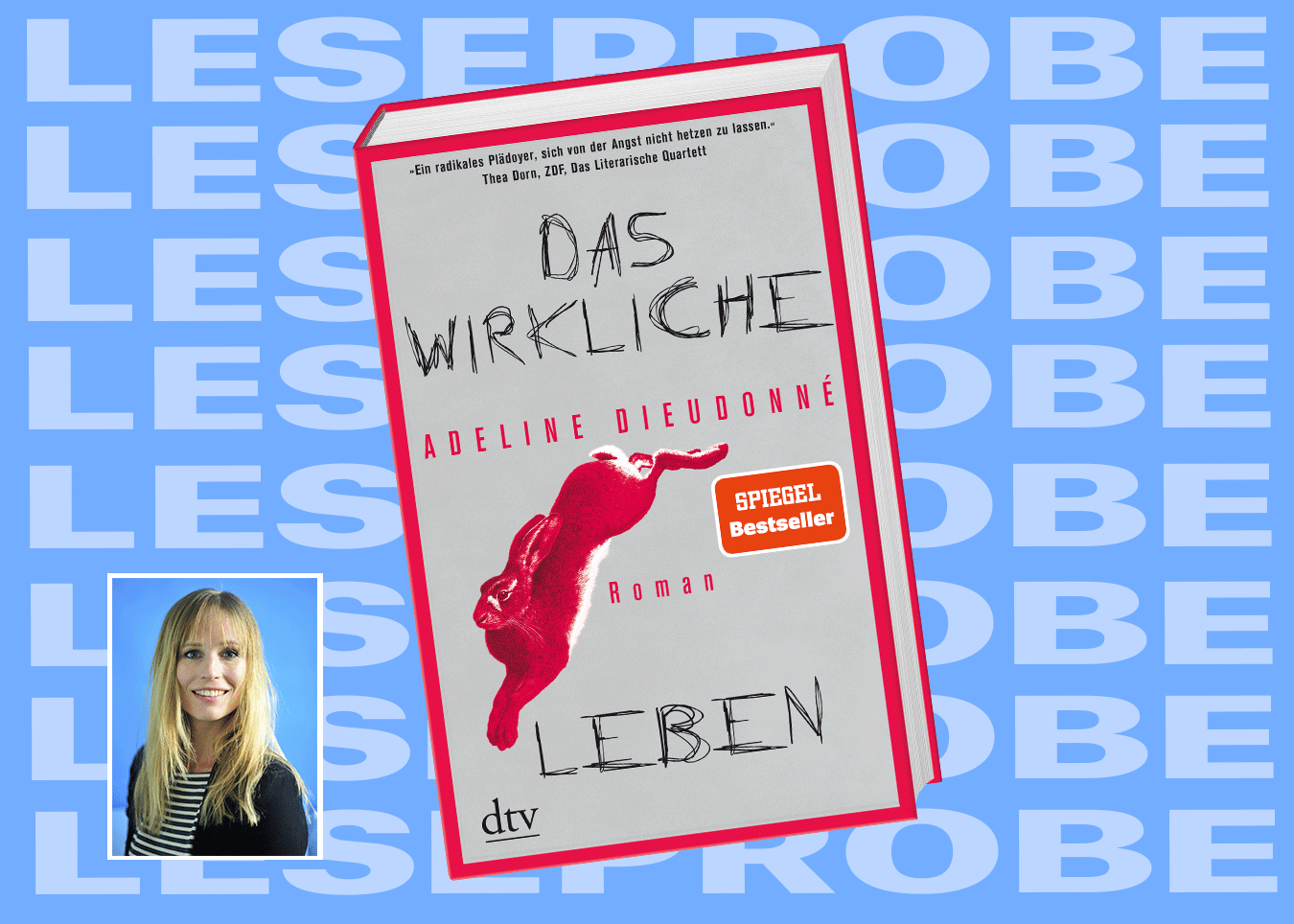
Foto: © Gwladys Louiset
Leseprobe: „Das wirkliche Leben” von Adeline Dieudonné
Bei uns zu Hause gab es vier Schlafzimmer. Meines. Das meines Bruders Gilles. Das meiner Eltern. Und das der Kadaver. Mazamas, Wildschweine, Hirsche. Antilopenschädel in verschiedenen Größen und von allen möglichen Arten: Springböcke, Wasserböcke, Impalas, Gnus, Oryxantilopen. Dann noch ein paar Zebraköpfe. Und auf einem Podest ein ganzer Löwe, die Zähne in den Hals einer kleinen Gazelle geschlagen. In einer Ecke schließlich – die Hyäne. Zwar war sie ausgestopft, doch sie lebte, da war ich mir sicher, und genoss den Schrecken in den Augen aller, die sie anzuschauen wagten. An den Wänden hingen gerahmte Bilder. Darauf war mein Vater mit den toten Tieren zu sehen. Es war immer die gleiche Pose: Ein Fuß auf dem Tier, eine Hand in die Hüfte gestemmt, reckte er mit der anderen stolz und zum Zeichen des Triumphs sein Gewehr in die Luft, was ihn weit mehr wie ein Rebell im Adrenalinrausch eines Genozids wirken ließ als wie ein Familienvater. Das Prunkstück seiner Sammlung, sein ganzer Stolz, war ein Elefantenstoßzahn. Eines Abends hatte er meiner Mutter erzählt, dass die größte Schwierigkeit nicht darin bestanden habe, den Elefanten zu erlegen. Das sei so einfach gewesen wie eine Kuh in einem U-Bahn- Tunnel zu erschießen. Nein, am schwierigsten sei es gewesen, Kontakt mit den Wilderern aufzunehmen und der Überwachung durch die Ranger zu entgehen. Und dann dem noch warmen Kadaver die Stoßzähne herauszubrechen. Ein richtiges Gemetzel sei das gewesen. Das alles hatte ihn ein kleines Vermögen gekostet. Ich denke, deshalb war er auch so stolz auf seine Trophäe. Einen Elefanten zu töten, ist derart teuer, dass er die Kosten mit einem anderen Kerl hatte teilen müssen. Und dann hatte jeder einen Stoßzahn mit nach Hause genommen. Ich strich gern über den Elfenbeinzahn. Er war so weich und groß. Aber ich musste es heimlich tun. Denn mein Vater hatte uns verboten, das Zimmer der Kadaver zu betreten.
Mein Vater war ein Koloss. Er hatte breite Schultern wie ein Abdecker. Und Hände wie ein Riese. Hände, die den Kopf eines Kükens ebenso leicht abschlagen konnten wie den Kronkorken einer Flasche Cola. Neben der Trophäenjagd hatte mein Vater noch zwei weitere Leidenschaften im Leben: fernsehen und Whisky trinken. Wenn er nicht gerade in den entlegensten Ecken der Welt nach Tieren zum Töten suchte, schloss er, eine Flasche Glenfiddich in der Hand, den Fernseher an die Lautsprecher- boxen an, die so viel gekostet hatten wie ein Kleinwagen. Und hin und wieder richtete er sogar das Wort an meine Mutter. Aber eigentlich hätte man sie auch durch einen Ficus ersetzen können, er hätte den Unterschied gar nicht bemerkt. Denn meine Mutter hatte Angst. Angst vor meinem Vater. Wenn man von ihrem Faible fürs Gärtnern und für Zwergziegen einmal absieht, lässt sich über meine Mutter sonst nicht viel sagen. Sie war eine hagere Frau mit langen, dünnen Haaren. Keine Ahnung, ob sie schon existiert hatte, bevor sie ihn traf. Ich nehme mal an ja. Sie muss allerdings damals schon einer primitiven, einzelligen, fast durchsichtigen Lebensform geglichen haben. Einer Amöbe: Ektoplasma, Endoplasma, Zellkern, Nahrungsvakuole. Durch das Zusammenleben mit meinem Vater hatte sich das bisschen Dasein dann nach und nach mit Furcht gefüllt.
„Irgendwann, als ich schon älter war, fragte ich mich, wie die beiden es geschafft hatten, zwei Kinder zu zeugen. Meinen Bruder und mich. Allerdings stellte ich meine Überlegungen rasch wieder ein, denn das einzige Bild, das mir in den Sinn kam, zeigte meinen nach Whisky stinkenden Vater bei einer Attacke spätabends auf dem Küchentisch.”
Ihre Hochzeitsfotos haben mich schon immer neugierig gemacht. Soweit ich in meiner Erinnerung auch zurückgehe, sehe ich mich im Fotoalbum nach etwas suchen, das ihre bizarre Verbindung erklären könnte. Liebe, Bewunderung, Achtung, Freude, ein Lächeln … irgendwas … Ich habe es nie gefunden. Auf den Bildern posierte mein Vater in derselben Haltung wie auf den Jagdaufnahmen, nur nicht so stolz. Klar, eine Amöbe gibt als Trophäe ja auch nicht wirklich viel her. Sie ist leicht einzufangen, ein Glas, ein wenig abgestandenes Wasser und schwupps, geschnappt. Angst hatte meine Mutter bei ihrer Hochzeit aber offenbar noch keine. Es sah nur so aus, als hätte jemand sie einfach so neben ihn gestellt, wie eine Vase. Irgendwann, als ich schon älter war, fragte ich mich, wie die beiden es geschafft hatten, zwei Kinder zu zeugen. Meinen Bruder und mich. Allerdings stellte ich meine Überlegungen rasch wieder ein, denn das einzige Bild, das mir in den Sinn kam, zeigte meinen nach Whisky stinkenden Vater bei einer Attacke spätabends auf dem Küchentisch. Ein paar schnelle Stöße, brutal und nicht gerade einvernehmlich, und das war’s … Die Hauptfunktion meiner Mutter bestand jedenfalls von Anfang an im Zubereiten der Mahlzeiten. Sie tat es wie eine Amöbe, ohne Kreativität, ohne Geschmack, dafür mit viel Mayonnaise. Meistens gab es Schinken-Käse- Toast, Dosenpfirsiche gefüllt mit Thunfischcreme, Russische Eier oder panierten Fisch mit Kartoffelpüree.
Hinter unserem Garten begann das Galgenwäldchen. Es lag in einem Tal, dessen bewaldete Hänge ein so steiles V bildeten, dass sich in der Talsohle das Laub sammelte. Ganz am Ende des Wäldchens, halb unter toten Blättern begraben, stand das Haus von Monica. Gilles und ich gingen sie oft besuchen. Denn Monica konnte gut Geschichten erzählen. Ihre langen, grauen Haare tanzten dabei über die Blumen ihres Kleides, und an ihren Handgelenken klimperten die Armreifen. Von ihr wussten wir, wie das V entstanden war. »Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte nicht weit von hier auf einem Berg ein Drachenpaar. Die beiden riesengroßen Drachen liebten sich so sehr, dass sie nachts immer miteinander sangen, so wundersam und schön, wie dies nur Drachen konnten. Gleichwohl jagte ihr Gesang den Menschen, die unten in der Ebene wohnten, Angst ein. Eine Angst, die immer größer wurde, sodass sie bald kein Auge mehr zutaten. Eines Nachts, als die Liebenden, müde und beseelt von ihrem Duett, eingeschlafen waren, schlichen die dummen Menschen mit Fackeln und Heugabeln bewaffnet hinauf auf den Berg und brachten das Weibchen um. Außer sich vor Kummer brannte der männliche Drache daraufhin mit seinem Feueratem die ganze Ebene nieder. Männer, Frauen, Kinder, alle starben. Danach durchpflügten seine gewaltigen Krallen die verbrannte Erde. Und so ist das Tal entstanden. Seitdem sind die Pflanzen zwar nachgewachsen und die Menschen zurückgekehrt, aber die Krallenspuren sind geblieben.«
Die Geschichte machte Gilles Angst. Abends kam er manchmal zu mir ins Bett gekrochen, weil er glaubte, den Drachen brüllen zu hören. Ich flüsterte ihm dann immer zu, dass es bloß eine Geschichte sei und es heute keine Drachen mehr gebe. Und dass Monica sie nur erzähle, weil sie Märchen liebe, aber das alles nicht wahr sei. Tief in mir regte sich trotzdem leiser Zweifel. Ich fürchtete sogar, mein Vater könnte eines Tages mit einem toten Drachen als Trophäe vom Jagdausflug zurückkehren. Um Gilles zu beruhigen, tat ich aber stets erwachsen und erklärte: »Geschichten sind dazu da, alles hineinzupacken, was uns Angst macht. Denn so können wir uns sicher sein, dass es nicht im wirklichen Leben passiert.«
„Meine Liebe zu ihm war die reinste Form der Liebe, die es auf der Welt gibt. Wie Mutterliebe. Eine Liebe, die keine Gegenleistung erwartet und durch nichts zerstört werden kann.”
Ich liebte es, an diesen Abenden mit Gilles’ kleinem Kopf direkt unter meiner Nase einzuschlafen und dabei den Duft seiner Haare einzuatmen. Gilles war in jenem Sommer sechs, ich war zehn. Normalerweise streiten sich Geschwister, sind aufeinander eifersüchtig, plärren einander an, liegen sich in den Haaren. Bei uns war das anders. Ich kümmerte mich um Gilles und brachte ihm alles bei, was ich wusste, so wie es die Aufgabe einer großen Schwester ist. Meine Liebe zu ihm war die reinste Form der Liebe, die es auf der Welt gibt. Wie Mutterliebe. Eine Liebe, die keine Gegenleistung erwartet und durch nichts zerstört werden kann. Wenn Gilles lachte, und das tat er ständig, sah man seine Milchzähne blitzen. Sein Lachen wärmte mich jedes Mal wie ein kleines Stromkraftwerk. Ich bastelte Handpuppen aus alten Socken, erfand dazu lustige Geschichten und führte sie für ihn auf. Oder ich kitzelte ihn. Einfach nur, um ihn lachen zu hören. Denn Gilles’ Lachen konnte alle Wunden heilen.
Monicas Haus war halb von Efeu überwuchert, was sehr hübsch aussah. Manchmal fiel durch die Zweige der Bäume auch die Sonne darauf, und ihre Strahlen wirkten dann wie Finger, die es streichelten. Unser Haus wurde von der Sonne nie so gestreichelt. Und auch nicht die Häuser in unserer Nachbarschaft. Wir wohnten in einer Siedlung, die »Demo« genannt wurde. Etwa fünfzig graue Einfamilienhäuser, aufgereiht wie Grabsteine. In den Sechzigerjahren hatte an derselben Stelle noch ein Weizenfeld gelegen. Zu Beginn der Siebziger war die Siedlung dann innerhalb von sechs Monaten aus dem Boden geschossen, wie eine Warze. Ein Pilotprojekt, errichtet nach dem neuesten Stand des Fertighausbaus. Die Demo. Eine Demonstration von was weiß ich. Die Erbauer wollten wohl irgendwas beweisen. Vielleicht hatte sie damals tatsächlich noch nach etwas ausgesehen. Jetzt, zwanzig Jahre später, war sie jedenfalls nur noch hässlich. Das Schöne, wenn es denn je existiert hatte, war vom Regen weggewaschen worden. Die Straße der Siedlung war als großes Rechteck angelegt worden, mit Häusern innen und Häusern außen. Unser Haus stand außen, an einer Ecke. Es war ein bisschen besser als die anderen, weil es der Architekt der Demo für sich selbst entworfen hatte. Er hat jedoch nicht lange darin gewohnt. Das Haus war größer als die anderen. Und heller, denn es hatte große Fensterfronten. Und es hatte einen Keller. Das klingt vielleicht albern, aber ein Keller ist wichtig. Er hält das Grundwasser davon ab, in die Mauern hochzusteigen. Die übrigen Häuser der Demo rochen wie ein muffiges Handtuch, das man in der Schwimmtasche vergessen hat. Bei uns roch es nicht schlecht, doch dafür gab es die ausgestopften Kadaver. Ich fragte mich manchmal, ob mir ein stinkendes Haus nicht lieber gewesen wäre.
„Der Augenblick, wenn mein Vater aufstand, um zum Sofa zurückzukehren, war für uns jedes Mal eine Befreiung.”
In jenem Sommer hatte meine Mutter an einem Abend mal wieder Dosenpfirsiche mit Thunfisch gemacht, die wir auf unserer blau gepflasterten Terrasse aßen. Mein Vater war schon aufgestanden und hatte sich mit seiner Flasche Glenfiddich vor den Fernseher verzogen. Er verbrachte nicht gern Zeit mit uns. Ich glaube, dass in dieser Familie keiner die gemeinsamen Abendessen mochte. Trotzdem hatte mein Vater uns dieses Ritual auferlegt. Und sich selbst auch. Weil es so zu sein hatte. Eine Familie isst gemeinsam zu Abend, ob es Spaß macht oder nicht. So wurde es einem im Fernsehen präsentiert. Nur dass die Leute im Fernsehen glücklich wirkten. Vor allem in den Werbespots. Da wurde diskutiert und gelacht die Leute sahen gut aus und liebten sich sehr. Die Zeit im Kreise der Familie wurde einem dort als Belohnung verkauft. Zusammen mit einem Ferrero Rocher war sie der Leckerbissen, den man sich nach stundenlanger Büroarbeit oder nach der Schule verdient hatte. Für uns dagegen waren die Familienessen eine Strafe, ein großes Glas Pisse, das wir Tag für Tag zu trinken hatten. Jeder Abend verlief nach dem gleichen Ritual. Mein Vater schaute zuerst die Nachrichten und erklärte meiner Mutter dabei jede Neuigkeit, da er sie für unfähig hielt, ohne seine Kommentare irgendwas zu kapieren. Die Tagesschau war meinem Vater heilig, denn die aktuellen Geschehnisse mit seinen Anmerkungen zu versehen gab ihm das Gefühl, in der Welt eine wichtige Rolle zu spielen. Als ob die Welt nur darauf wartete, um sich seinen Überlegungen entsprechend weiterzudrehen. Sobald dann die Schlussmelodie ertönte, rief meine Mutter »Essen!«, mein Vater ließ den Fernseher laufen und alle setzten sich an den Tisch, wo wir schweigend zusammen aßen. Der Augenblick, wenn mein Vater aufstand, um zum Sofa zurückzukehren, war für uns jedes Mal eine Befreiung.
Das war an diesem Abend nicht anders. Gilles und ich sprangen vom Tisch auf, um zum Spielen in den Garten zu gehen. Die Abendsonne duftete nach karamellisiertem Honig. Im Hausflur putzte meine Mutter Cocos Käfig. Einmal hatte ich meiner Mutter zu erklären versucht, dass es grausam sei, den Wellensittich im Käfig zu halten. Vor allem, weil in der Demo jede Menge Sittiche frei herumflogen. Anscheinend wurden sie sogar lang- sam zum Problem, weil sie den kleineren heimischen Vögeln, Spatzen und Meisen, das Futter wegfraßen. Bei uns im Garten fraßen sie die Kirschen, noch bevor diese Zeit gehabt hatten, zu reifen. Die Sittiche waren da, weil es wenige Kilometer von der Demo entfernt mal einen Zoo gegeben hatte. Einen kleinen Zoo. Aber er hatte Pleite gemacht wegen eines Vergnügungsparks, der nicht weit von hier eröffnet und seine Besucher weggelockt hatte. Sämtliche Tiere waren an andere Zoos verkauft worden. Bis auf die Wellensittiche. Die wollte niemand. Da es zu viel kostete, sie irgendwo anders unterzubringen, öffnete der Zoodirektor deshalb einfach die Käfige. Vielleicht dachte er, dass sie in der freien Natur bald erfrieren würden. Aber sie waren nicht gestorben. Im Gegenteil, sie hatten sich angepasst, Nester gebaut und Junge bekommen. Wenn sie aufflogen, bildeten sie große grüne Wolken am Himmel. Das war immer schön anzusehen. Richtig schön, wenn auch laut. Deshalb verstand ich nicht, warum der arme Coco im Käfig bleiben und zuschauen musste, wie sich die anderen ohne ihn amüsierten. Meine Mutter sagte, das sei nicht das Gleiche, er stamme aus einer Zoohandlung und sei ans Leben draußen nicht gewöhnt. Trotzdem sollte er frei sein! Meine Mutter putzte also Cocos Käfig, als draußen der ›Blumenwalzer‹ erklang. Zeit für unser Eis.
„Ich erinnere mich noch ganz genau an den Knall. Er ging mir durch Mark und Bein, prallte gegen alle Mauern unserer Siedlung. Er musste bis ins Galgenwäldchen, bis zu Monicas Haus zu hören gewesen sein. Mein Herz setzte zwei Schläge aus. Dann sah ich sein Gesicht. Der Siphon war mit voller Wucht hineingeknallt. Wie ein Auto in eine Hausfassade.”
Der Lieferwagen hatte an der Hecke vor unserem Haus gehalten, und der alte Eismann war bereits von einem Dutzend lärmender Kinder umringt. Monica hatte mir irgendwann erklärt, dass er ganz anders als der Schrotthändler sei. Er sei sanft und freundlich. Wie sie so von ihm sprach, hatte ich etwas Sonderbares in ihren Augen gesehen. Beide waren schon alt. Darum kam mir der Gedanke, dass früher vielleicht einmal etwas zwischen ihnen gewesen war. Vielleicht gab es da eine schöne Liebesgeschichte, die durch eine lange zurückreichende Familienfehde abrupt beendet worden war? Ich las damals ziemlich viele Liebesromane. Als der Eismann Gilles seine Waffel mit dem Vanille- und Erdbeereis reichte, schaute ich auf seine Hände. Alte Hände haben etwas Beruhigendes. Die Vorstellung, dass ihre feine, ausgeklügelte Mechanik dem netten alten Herrn schon so lange gehorchte, und der Gedanke an das viele Eis, das sie hergestellt hatten, gaben mir den Glauben an etwas, das ich zwar nicht genau beschreiben konnte, das aber auf jeden Fall beruhigend war. Und zudem waren sie schön, die dünne Haut über den hervortretenden Sehnen, die Adern bläulich schimmernd wie kleine Bäche … Der Eismann sah mich mit einem Lächeln in den Augen an. »Und was magst du haben, meine Kleine?« Ich war an der Reihe. Mein Spruch ging mir schon seit fünf Minuten im Kopf herum. Ich weiß nicht, warum, aber wenn ich ein Eis bestellte, improvisierte ich nicht gern. Ich war jedes Mal erleichtert, wenn vor mir noch jemand in der Schlange stand, weil ich so Zeit hatte, mir meinen Satz zu überlegen. Damit er gut herauskam, ohne Zögern. Zum Glück waren mein kleiner Bruder und ich heute die Letzten. Alle anderen Kinder hatten ihr Eis schon bekommen und waren gegangen. »Schokolade-Stracciatella in der Waffel und mit Sahne, bitte.« »Mit Sahne also, Mademoiselle. Selbstverständlich!« Beim Wort »Sahne« zwinkerte er mir zu, um mir zu signalisieren, dass das immer noch unser Geheimnis war. Und dann machten sich seine beiden Hände an die Arbeit, führten zum hunderttausendsten Mal ihren kleinen Tanz auf. Die Waffel … der Eisportionierer … die Kugel Schokolade … der Becher mit dem warmen Wasser … eine Kugel Stracciatella … der Sahnespender, ein Siphon aus Edelstahl, gefüllt mit echter Schlagsahne … Der alte Herr beugte sich vor, um ein hübsches Sahnehäubchen auf mein Eis zu spritzen. Auf die luftige Spirale konzentriert, die blauen Augen weit geöffnet, setzte er den Siphon mit einer eleganten, präzisen Handbewegung an, die Hand nah am Gesicht. Und dann, als er am Gipfel des hübschen Sahnehäubchens angelangt war, als seine Finger gerade den Druck wegnehmen und er sich wieder aufrichten wollte – explodierte der Sahnespender. Bumm. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Knall. Er ging mir durch Mark und Bein, prallte gegen alle Mauern unserer Siedlung. Er musste bis ins Galgenwäldchen, bis zu Monicas Haus zu hören gewesen sein. Mein Herz setzte zwei Schläge aus. Dann sah ich sein Gesicht. Der Siphon war mit voller Wucht hineingeknallt. Wie ein Auto in eine Hausfassade. Die eine Gesichtshälfte fehlte. Sein kahles Schädeldach war noch intakt, das Gesicht hingegen nur noch eine Mischung aus Fleisch, Blut und Knochen. Und mitten drin: das eine Auge in seiner Höhle. Es schaute überrascht, das blaue Auge. Ich habe es genau gesehen. Ich hatte genug Zeit. Denn der alte Herr blieb noch ein paar Sekunden wie erstarrt stehen, als ob sein Rumpf so lange bräuchte, um zu begreifen, dass nur noch ein zerfetzter Schädel auf ihm saß. Dann brach er zusammen. Es war wie ein schlechter Scherz. Ich hörte sogar ein Lachen. Es kam nicht von mir, es war überhaupt kein reales Lachen. Ich denke, es war der Tod. Oder das Schicksal. Jedenfalls etwas, das um ein Vielfaches größer und gewaltiger war als ich. Eine übernatürliche, allmächtige Kraft, die an diesem Tag anscheinend zu Späßen aufgelegt war und beschlossen hatte, sich mit dem Gesicht des Alten einen Scherz zu erlauben. An das, was danach geschah, erinnere ich mich nur noch vage. Ich schrie. Leute kamen angerannt. Sie schrien ebenfalls. Mein Vater kam. Gilles neben mir rührte sich nicht. Seine großen Augen und sein kleiner Mund waren weit aufgerissen, seine Hand hielt die Waffel mit dem Erdbeer- und Vanilleeis fest umklammert. Ein Mann neben uns erbrach Melone mit Parmaschinken. Die Ambulanz kam, dann der Leichenwagen.
Mein Vater führte uns schweigend ins Haus. Meine Mutter fegte vor Cocos Käfig auf. Mein Vater setzte sich wieder vor den Fernseher, und ich zog Gilles an der Hand zum Ziegengehege. Mit starrem Blick und offen stehendem Mund folgte er mir wie ein Schlafwandler. Der Garten, das Schwimmbecken, der hereinbrechende Abend: Alles erschien mir unwirklich. Besser gesagt: in eine neue Wirklichkeit getaucht. In die grausame Wirklichkeit von all dem Fleisch und Blut, dem Schmerz und dem linearen, unerbittlichen Vergehen der Zeit. Aber vor allem in die Wirklichkeit dieser übernatürlichen Kraft, die ich lachen gehört hatte, als der alte Mann zusammengesackt war. Dieses Lachen, das weder von mir noch von sonst jemandem kam – und das doch gleichzeitig überall war. So wie diese allmächtige Kraft. Auch mich konnte sie treffen. Jederzeit und überall.
In Kooperation mit dem dtv Verlag.