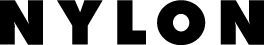Warum ihr mit leichtem Gepäck reisen solltet
Auf einer Reise zu wenig einzupacken kann überraschend befreiend sein. Ein Plädoyer.
Text: Gray Chapman

Einer meiner erfreulichsten Käufe, die ich im gesamten Jahr 2016 getätigt habe, war ein labelloser hautfarbener BH, den ich für lächerliche ¥1400 (in etwa 11 Euro) erstand, inmitten des angenehm geschäftigen Treibens im Erdgeschoss der Kyoto Station in Japan. Der BH selbst war eigentlich nichts Besonderes – völlig unscheinbar, null Dekoration, einfach funktionale Unterbekleidung, noch nicht Mal mit Bügel, aber in dem Moment als er mein Eigen wurde, hüpfte ich in die nächste Toilette, schälte mich aus meinem verschwitzten, stinkenden Minimizer von Wacoal und tauschte ihn gegen dieses unbefleckte, trockene, glorreiche Stück Textil.
Ich fühlte mich wie neugeboren.
Das passierte auf einer Reise durch Japan, bei der ich mit nichts als einem Rucksack und entsprechend reduziertem Inhalt unterwegs war. In jenem September schwankte das Wetter von einem Extrem ins andere: Sintflutartige Regenfälle wechselten sich mit einer erdrückenden Schwüle ab, so als wäre man eng in eine nasse Decke eingewickelt. Ich hatte die Wahl zwischen vier Outfits, während ich durch Bergtempel wanderte, durch Harajuku spazierte, lange Radtouren durch die Täler der japanischen Alpen unternahm oder mit Schneeaffen abhing. Wir waren fast jeden Tag unterwegs, so dass mein ursprünglicher Plan, meine Klamotten mit der Hand zu waschen und lufttrocknen zu lassen, nicht aufging. Zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Zug in Kyoto ankamen, war jedes Teil meiner Garderobe vom Regen durchnässt oder total durchgeschwitzt. Es ist überflüssig zu erwähnen, dass ich mich fürchterlich fühlte.
Ich bin weder eine Mode-Bloggerin, noch entspanne ich mich beim Anblick interessant aussehender Türrahmen, die mit flatternden Hippie-Jumpsuits dekoriert sind. Aber Social Media und die Tatsache, dass ich mit einem Fotografen verheiratet bin, haben meinen Anspruch an die Dokumentation einer Reise durchaus angehoben, oder um es mit knappen Worten zu sagen: Fotos sind in diesem Kontext unvermeidbar. Und natürlich bemühe ich mich, darauf halbwegs annehmbar auszusehen.
Auf meiner Japan-Reise ließ ich diesen Anspruch ziemlich schnell hinter mir (ebenso wie das Paar High Heels an Tag drei in einem Hotel in Tokio, denn wenn du deine Sachen auf dem Rücken tragen musst, verschieben sich Prioritäten recht schnell.) Ich erinnere mich lebhaft daran, als ich Naras heiligen Tempelkomplex besuchte und dabei das einzige noch saubere Outfit trug: einen schwarzen Rollkragenpullover mit Leo-Print und einen Minirock. Eine Kombination, die ich normalerweise in Bars anziehe. Darin einem gewaltigen Buddha standhalten oder heilige Kühe füttern? Puh.
Auf dem ersten Teil der Reise fühlte ich mich also schlampig, nicht wirklich wohl in meiner Haut, und, am allerschlimmsten: Auffallend unattraktiv. Doch dann stellte sich ganz allmählich ein Sinneswandel ein. Ich hörte auf, darüber nachzudenken. Weniger Auswahl zu haben bedeutete nämlich auch, dass ich im Nu angezogen war und mich ganz auf die Reise konzentrieren konnte, anstatt mir vor einem vollgestopften Koffer mit Madewell-Lieblingsstücken jeden Tag aufs Neue den Kopf über mein Outfit zu zerbrechen. Musste ich mir wirklich selbst beweisen, dass ich im Stande bin, ein Abenteuer zu bestreiten und dabei unangestrengt und atemberaubend auszusehen? Nein. War ich wirklich neidisch auf die Tokioter Frauen, die ich über Ginzas Straßen schweben sah, in ihren makellosen, luftigen Ensembles? Oh ja! Aber als ich endlich realisiert hatte, dass es einfach unmöglich war, in meiner Situation gut auszusehen, konnte ich meine Eitelkeit endlich ablegen. Und das macht die Dinge im Handumdrehen wesentlich leichter.
Im letzten Jahr sinnierte ein Condé Nast Reise-Redakteur darüber, wie Influencer mit ihrem Anspruch an das perfekte Selfie, die Reinheit und Faszination des Reisens zunichte machen. Anstatt sich der ungekünstelten Schönheit zu widmen und ihr den entsprechenden Respekt zu zollen, sind Touristen dazu übergangen, sich selbst in Landschaften zu implementieren, dabei die Faszination des Drumherums völlig zu vergessen und vielmehr die Großartigkeit der Natur als schnöde Kulisse für ihre Fotos zu nutzen. Fürs Protokoll: Ich glaube nicht, wie er propagiert, dass Instagram „das Reisen ruiniert“ oder das Instagramer „unseren Blick zerstören“ (Es ist der Grand Canyon! Da ist für alle Platz! Eine „kleine Fee mit Designer-Hut“ dürfte deinen Blick nicht großartig beeinträchtigen.).
Ich bin zwar niemand, der sich aufdrängt wenn es die Möglichkeit gibt, auf einer Reise fotografiert zu werden, dennoch frage ich hin und wieder meinen Mann danach, ein verwegenes Instagram-Foto von mir zu schießen. Aber wenn du dich in Sportklamotten schwerfällig durch die windigen Gassen von Kyoto schleppst, auf der Suche nach einem Waschsalon, verschiebt sich diese Dynamik doch ein wenig. Zumindest bei mir war das so. Sich wie ein furchtbar angezogenes Monster zu fühlen ist alles andere als ideal und ich bin die erste, die zugibt, dass es kein Hexenwerk ist, ein wenig intelligenter zu packen – aber um ehrlich zu sein: Ich glaube wirklich nicht, dass ich auf meiner nächsten Reise einen Koffer dabei haben möchte, der vollgestopft ist mit tollen Klamotten. Und das nicht nur, weil die Minimierung der Möglichkeiten, die Kapazitäten des Gehirns verbessert und keine unnötige Zeit dafür drauf geht, über Kleidung zu sinnieren; auch und vor allem weil es mich von dem Drang befreit, mein Gesicht in die Kamera zu halten. Es hilft dabei, alles in mich aufzusaugen, diese einmal-und-nie-wieder-Momente des Lebens in vollen Zügen zu genießen. Und ja, vielleicht auch, um sich ein klein wenig demütig zu fühlen. Weil man in dieser wunderbaren Welt leben darf, anstatt jeden fantastischen Ort als Instagram-Kulisse zu nutzen. Nur ein paar mehr saubere BHs werde ich beim nächsten Mal vielleicht einpacken. Kommt schon, Unterwäsche zählt nicht.